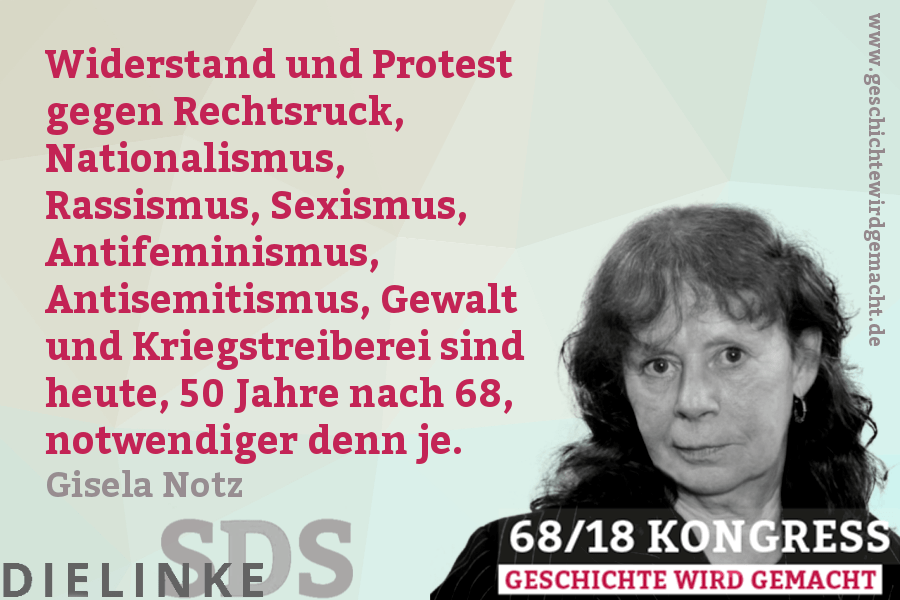Samstag, 16 Uhr. Jede Woche treffen sich die Muananas zum Nähen im Abstellraum der RBF. Bis zum Umzug 2017. Inzwischen ist dort eine Kita für die ganz Kleinen entstanden. Nach und nach trudeln alle ein: H., ein Tuareg aus dem Niger, der inzwischen super nähen kann. Durch das Projekt hat er seine Freude am Nähen entdeckt. Er näht viel für sich selbst. Er hat ein Angebot für einen Ausbildungsplatz zum Schneider, leider steht aber noch der Kampf um einen Aufenthalt im Vordergrund. Kurz danach kommt der andere H. Er bereichert mit seinen Erzählungen, seiner Fürsorge um die andern und der Sonne, die er stets mitbringt, das Projekt. Er ist ein Tubu aus dem Tschad. Wir freuen uns alle mit ihm, als er nach 3 Jahren Kampf endlich Asyl bekommt. Mühsam bringt er sich lesen und schreiben bei. Die nächste Schule war 100 km von seinem Heimatort entfernt. Wie viele andere konnte er deshalb nur 2 Jahre eine Koranschule besuchen. Seit Jahren fordern die Bewohner*innen eine staatliche Schule. Bei einer der Demonstrationen dafür wurden im letzten Jahr 6 Menschen erschossen. I. aus Mali hat mit Unterstützung der Kirche inzwischen einen Aufenthalt. Er ist sehr fleißig. Er kommt immer zum Nähen, außer, wenn er krank ist. Auf den Märkten hat er stets sein Deutschbuch aufgeschlagen und bittet um Hilfe bei seinen Hausaufgaben. M. ist ein Freund aus Mali. Wie I. hat er inzwischen das Nähen gelernt. Er kämpft noch um seinen Aufenthalt. Er sammelt Geld für einen tiefen Brunnen für sein Dorf, mit einer Wasserpumpe. Dort gibt es noch keine Elektrizität, und der bestehende Brunnen hat nur in der Regenzeit Wasser. Hilfe von der Regierung ist nicht zu erwarten. Deshalb liegen hohe Erwartungen auf ihm. M. ist in Libyen aufgewachsen, ein Teil seiner Familie lebt im Niger. Er ist stets multitasking, trotz 2 Jobs und unzähligen Aktivitäten kommt er fast immer zum Nähen. Inzwischen hat er einen festen Aufenthalt. M. ist Schneider aus dem Senegal. Er bereichert das Projekt mit seinen Ideen: er zaubert wunderschöne Haarbänder, mit den Ornamenten von afrikanischen Stoffen kreiert er wunderschöne Jacken, Hemden, Kleider und Vieles mehr. Und dann bereichert noch A., ein Tuareg aus dem Niger, unser Projekt: nach der Räumung des Camps am Oranienplatz ging er zunächst zurück nach Italien. Die Chancen für Geflüchtete aus Afrika, dort einen Job zu finden, sind mehr als gering. A. jedoch kaufte sich mit wenig Geld ein gebrauchtes Auto. Er überlebte fast eineinhalb Jahre als informeller taxi-driver. Irgendwann hatte er so viele Aufgriffe durch die Carabinieri, dass sie ihm mit Gefängnis drohten. Daraufhin machte er sich Anfang 2017 auf die Rückreise nach Berlin. Er brauchte 2 Anläufe, beim ersten Versuch wurde er in Österreich inhaftiert und zurückgeschickt. In Berlin war er dann einer der ersten vom ehemaligen Oranienplatz-Camp, die mit Unterstützung der Kirche einen Aufenthalt bekamen. Er telefonierte – damals noch auf Englisch – mit Hilfe des Internets viele Firmen ab und fand sofort Arbeit, er wollte nie etwas mit dem Jobcenter oder Sozialamt zu tun haben. Im Sommer 2017 kam er irgendwann zum Nähen und eröffnete uns: „Ich werde jetzt eine Band gründen“. Er hatte einen Gitarristen kennengelernt, der ihn beeindruckte. Er wollte traditionelle Tuareg-Lieder singen, dazu eigene Kreationen. Ein alter Freund hatte bereits im Niger auf der Djembé gespielt. Wenig später traten sie zum ersten Mal auf…und bis zum Lockdown hatten sie so viele Kontakte und Auftritte, dass sie sich vor Anfragen teilweise kaum retten konnten.
Nun, Jahre später, nach Lockdowns und dem Ausfallen der für uns wichtigen Feste und Märkte, ist Muanana mehr denn je zum festen Bestandteil der Kerngruppe geworden. Es kamen weitere Teilnehmer*innen dazu, untereinander sind sie stets im Austausch, unterstützen sich gegenseitig. Als S. in das Urban-Krankenhaus kommt, bringt ihm M. noch am gleichen Tag Kopfhörer vorbei. Als H. seinem gehbehinderten Bruder einen Rollstuhl in den Tschad schicken muss, machen sich alle auf die Suche nach einer Transportmöglichkeit. Alle sind in der gleichen Situation: die Familien bitten sie, Geld für das Schulgeld der Geschwister zu schicken, für Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, teilweise einfach für Essen, um mit der Familie über die Runden zu kommen. Der Erlös aus den genähten Utensilien trägt ein Stück weit mit dazu bei, etwas von diesem Druck wegzunehmen. Nicht wenige vom ehemaligen Oranienplatz-Camp haben die Unsicherheit, was aus ihnen werden würde, und den Druck von allen Seiten nicht ausgehalten. Sie wurden krank, begannen, sich – mit was auch immer – dicht zu machen. Mit dem Projekt wollten wir ein Stück weit mit dazu beitragen, dass sich die Geflüchteten hier willkommen fühlen. Ich hoffe sehr, dass uns dies gelungen ist.
Christa