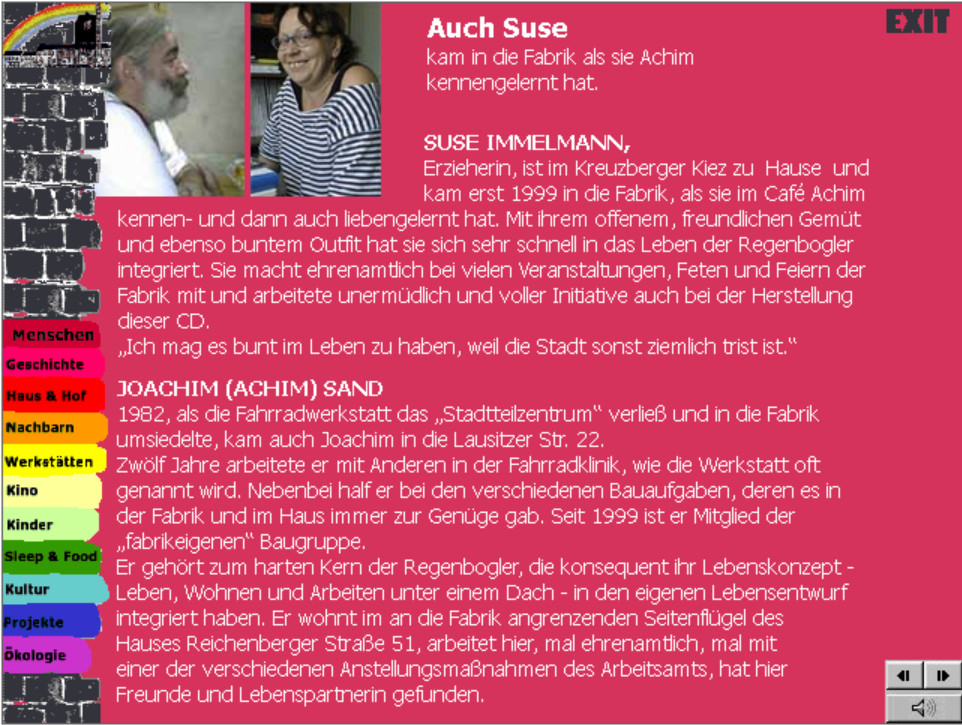Dies schrieb ich 2004 an Christian: Es ist über 20 jahre her, dass ich bei euch mal gewesen bin. es war kurz vor der hochzeit von johanna und karl. sie hatten uns beide gefragt, ob wir ihre trauzeugen sein wollten. deswegen hatten wir uns verabredet. wir wollten besprechen, was wir in diesem gottesdienst sagen wollten.
ich kam also in die oppelnerstraße, stieg die treppe hoch und stand vor eurer tür. ich klingelte. erst mal passierte nix. dann öffnete jemand und sagte: „ach du warst das. du mußt doch gar nicht klingeln, hier ist die tür immer offen.“ damit hatte ich nicht gerechnet. die tür hatte einen knauf, aber der ließ sich drehen. da war eine wohnung, die stand allen offen, keine furcht, das da „was wegkommt“. das hat mich sehr beeindruckt. und über die lange zeit habe ich erfahren dürfen: offen steht nicht nur eure tür, sondern auch eure herzen.
Heute, voller Traurigkeit, finden wir schwer die richtigen Worte. Dabei gibt es so viel zu erinnern zur Verbundenheit, die Christian zu einigen Menschen hier im Haus hatte. So erinnern wir statt dessen an einen Artikel von Philipp Gessler, der 2016 für die taz ein Portrait von Christian verfertigt hat.
Praktizierte Nächstenliebe in Berlin:
Das Heilige auf der Straße
Fast 40 Jahre lang stand seine Wohnungstür in Berlin-Kreuzberg jedem offen. Der Jesuit Christian Herwartz wird jetzt etwas Neues anfangen.
BERLIN taz | Ist das etwa der liebe Gott? Jedenfalls sieht der Obdachlose so aus – lange weiße Haare, Vollbart, wallendes Hemd und eine weite Hose. Etwas irritierend ist der zackige Spiegel, der an einer Schnur um seinen Hals baumelt, die nackten Füße stecken in Badeschlappen. Er drückt auf die Klingel der „WG Herwartz“ am Eingang des Hauses Naunynstraße 60, gleich neben der Kneipe Der Trinkteufel in Berlin-Kreuzberg.
Die Tür öffnet sich, ohne Nachfrage. Im dritten Stock steht die Wohnungstür auf, verschiedene, meist nicht mehr ganz junge Menschen, tragen Tassen und Teller in das WG-Wohnzimmer. Es ist Samstagmorgen, und wie immer samstags zwischen halb zehn und halb zwölf, ist jeder, der mag, zu einem offenen Frühstück eingeladen. An der langen Holztafel, an der etwa 15 Leute sitzen, ist noch ein Platz frei, neben Christian Herwartz. Der liebe Gott neben dem Heiligen von Kreuzberg.
Dass Herwartz ein Heiliger von heute sein könnte, das hat Pater Klaus Mertes mal angedeutet, ebenfalls ein mutiger Jesuit, der als Rektor des Canisius-Kollegs vor sechs Jahren den Missbrauchsskandal in seinem Gymnasium aufdeckte – und damit die katholische Kirche im Innersten erschütterte. Aber was ist schon heilig?
Charme einer Studi-WG
Beim Samstagsfrühstück thront Christian Herwartz jedenfalls ein wenig wie ein Buddha in der Mitte der Tischrunde – wer kann, bringt etwas zum Essen mit. Seit 1978 lebt der Priester in Kreuzberg.
Hier siedelte sich seine kleine Jesuiten-Wohngemeinschaft an, die noch heute den gemütlich-schmuddeligen Charme einer Studenten-WG besitzt und aus zwei übereinanderliegenden Dreizimmerwohnungen besteht. An den Wänden Poster, die ein Ende der Abschiebungen von Flüchtlingen fordern. In der Küche hängt über der Spüle eine Postkarte: „Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu bauen.“ Eine Spülmaschine gibt es nicht.
Die WG ist über die Jahre eine Anlaufstelle für alle geworden, die eine Bleibe für eine oder auch mehrere Nächte brauchen. Wenn die Wohnung nicht voll belegt ist, darf jeder bleiben, so lange er will. Manche blieben Jahre. Menschen aus fast 70 Nationen haben auf diese Weise in der WG Herwartz eine zeitweilige Unterkunft gefunden.
In der Tradition der Arbeiterpriester
Niemand wird hier gefragt, woher er kommt und warum er da ist. „Das ist eine Polizeifrage“, sagt Herwartz mit unerwarteter Schärfe, die man anfangs seiner sanften Stimme gar nicht zugetraut hätte. Der Jesuit schläft in einem Siebenbettzimmer mit den Leuten, die sich gerade in der WG aufhalten. Seit Jahrzehnten macht er das so. Weltweit gesehen, sei das doch völlig normal, erklärt er – und wenn er mal Ruhe oder Privatsphäre braucht, geht er eben für ein Stündchen in den Park.
Christian Herwartz, 1943 in Stralsund geboren, ist ein massiger Mann mit Halbglatze und langem weißen Bart – die ideale Besetzung für eine Klosterbräuwerbung. Er trägt Pulli und Hose – nichts, was anzeigt, dass er Priester ist, nichts, was ihn von anderen unterscheidet.
Seit mehr als 40 Jahren ist er Jesuit, aber keiner der vergeistigten Sorte. Das sieht man an seinen Händen: Es sind große Arbeiterhände, und das ist kein Zufall, denn Jahrzehnte lang war Herwartz ein Arbeiter. Nach dem Abbruch der Schule ging er – sein Vater war im Krieg U-Boot-Kommandant – in Kiel auf eine Werft und lernte Dreher. Später holte er das Abitur nach und arbeitete ab 1975 für drei Jahre in Frankreich als Arbeiterpriester.
Das Tattoo
Arbeiterpriester gab und gibt es vor allem in Frankreich, denn während des Kriegs folgten katholische Priester den nach Deutschland verschleppten französischen Zwangsarbeitern, um ihnen beizustehen. Dass sie Priester waren, durfte niemand wissen – sonst drohte ihnen das KZ. Noch heute halten Arbeiterpriester ihre Weihe in der Regel verborgen, da ihnen Entlassung droht, wenn ihre priesterliche Funktion im Betrieb öffentlich wird. Sie gelten oft als Sozialisten und Interessenvertreter der Belegschaft.
Auch Herwartz hielt seine Identität als Arbeiterpriester bei Siemens in Berlin bis zum Jahr 2000 geheim – dann wurde er entlassen. Der Priester, der sich selbst als „68er“ bezeichnet und schon mit RAF-Leuten in Haft saß, sieht sich als Antikapitalist. Den Mauerfall etwa bezeichnet er als „feindliche Übernahme“ des Ostens: „Der Kapitalismus hat gesiegt.“ Das Äquivalent zum Auftrag Gottes an Mose, sein Volk aus Ägypten zu führen, wäre heute vielleicht: „Du sollst Deutschland aus dem Kapitalismus führen“, überlegt Herwartz. Mose ist eine wichtige Figur im Denken des Jesuiten: Den brennenden Dornbusch, in dem Mose Gott erkannte, hat Herwartz sich auf seinen linken Arm tätowieren lassen.
Das Nichtfragen nach dem Woher und Wohin seiner Gäste ist Prinzip in der Herwartz-WG. Denn für manche hätte sich die Polizei sicher interessiert. Herwartz deutet auf das Bild eines vielleicht zehnjährigen blonden Mädchens auf der gegenüberliegenden Wand: Das Mädchen kam hierher, nach vier Monaten auf der Straße, mit ihrem Vater – juristisch gesehen, war es eine Entführung. Die alkoholkranke Mutter der Kleinen sollte nicht wissen, wo sie waren. Dem Mädchen drohte, erzählt Herwartz, der Missbrauch durch ihren neuen Stiefvater. Der war wegen solcher Taten schon verurteilt worden. Missbrauch, Flüchtlinge, Obdachlosigkeit, Haft – in all den Jahren haben sich durch die Gäste in der Kreuzberger WG viele Konflikte in der Gesellschaft früh abgezeichnet, sagt Herwartz.
Von Camara bis Woelki
Und vieles ist zum Weinen. Das Mädchen, das von seinem Vater entführt worden war und in der WG lebte, ist mittlerweile tot. Gestorben bei einem Brand in der Wohnung ihrer Mutter, zu der sie nach zwei Monaten in der WG doch zurückkehren musste. Es ist eine traurige Wand, an dem das Bild des Mädchens hängt. Hier befinden sich die Fotos der Toten der WG. „Sie sind alle noch da“, sagt Herwartz beim Frühstück.
Die Toten sind willkommen, die Lebenden auch – selbst wenn es kirchliche Würdenträger sind. In der Kreuzberger WG-Küche saßen schon der vorherige und der jetzige Erzbischof von Berlin, Woelki und Koch – oder etwa der linke Befreiungstheologe und Erzbischof Dom Helder Camara aus Brasilien. Er war der erste Oberhirte, der die WG besuchte, betont Herwartz. Das passt. Denn der Jesuit hält nicht viel von der verfassten katholischen Kirche in Deutschland: Sie sei praktisch die einzige katholische Kirche weltweit, bei der Geld und Glaube verheiratet seien, sagt er. Die Kirchensteuer habe eben „ihre Folgen“, ergänzt er trocken, „ohne sie wären wir viel freier“.
Exerzitien und Reisen
An diesem Samstagmorgen findet das vorerst letzte Frühstück mit Herwartz statt, am Ende dieser Woche will er nach fast 40 Jahren aus der WG ausziehen. Die Samstagsfrühstücke gehen weiter, nur eben ohne ihn. Als sein Mitbruder Franz vor zwei Jahren starb, wurde ihm klar, dass nun ein Generationswechsel nötig wird. Was er danach macht? „Eine Idee habe ich noch nicht“, sagt Herwartz. Er wolle eine kleine Lesereise für sein neuestes Buch machen, Exerzitien geben und sich bei Leuten bedanken, die ihn über so viele Jahre begleitet hätten. Eine davon ist eine Freundin, die in der WG wohnte und nun einen Bauernhof in Süddeutschland hat – der Hof mit ein paar Kühen findet sich als kleines gemaltes Bild an einer Wand des Wohnzimmers. Es sieht nach Heimat aus.
Beim Frühstück taucht plötzlich Alain auf, ein schmächtiger, klappriger Mann, der gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er war todkrank. Alain bricht fast die Stimme, als er sagt, er hätte doch noch einmal vorbeikommen wollen. Herwartz führt ihn mit seinen riesigen Händen fast zärtlich zu einem freien Stuhl. Um ihn aufzuheitern, singt ein indischer Gast mit eindrucksvoller Stimme am Frühstückstisch ein bengalisches Liebeslied. Niemand versteht ein Wort, alle verstehen alles.
Mit einigen Mitbrüdern hat Herwartz die interreligiösen „Straßenexerzitien“ entwickelt, die mittlerweile weltweit praktiziert werden. Ein Thema, über das er sich gerne auslässt. Die Idee dahinter ist, sich für diese geistigen Übungen nicht ein paar Tage lang in ein ruhiges Kloster mit Vollpension in einer idyllischen Landschaft zurückzuziehen. Sondern genau das Gegenteil zu versuchen: eine Meditation, eine Reflexion, vielleicht sogar das Erlebnis einer Gottesnähe im Lärm, im Dreck und im Elend der Großstadt zu suchen – etwa vor dem Abschiebegefängnis in Grünau, wo Herwartz mit anderen seit vielen Jahren gegen die deutsche Flüchtlingspolitik demonstriert und betet.
Das Fremde zulassen
In einem Aufsatz zum jüngsten von Christian Herwartz herausgegebenen Buch hat das Pater Mertes einmal so beschrieben: „Auf der Straße gibt es Gut und Böse, Begegnung und Gewalt. Die Gewaltverhältnisse, die die Armen auf die Straße drücken, wiederholen sich auf der Straße. Doch mittendrin kann ein Dornbusch brennen, der nicht verbrennt, mittendrin auf der Straße, wo alles offen liegt.“
Es gehe dabei darum, sagt Herwartz, wie Mose vor dem brennenden Dornbusch die Schuhe auszuziehen, was bedeutet: sich ungeschützt einzulassen auf den Ort oder die Begegnung, die fremd ist, aber heilig sein könnte. Herwartz sucht das Heilige auf der Straße. Er findet es in jedem Menschen.
https://taz.de/Praktizierte-Naechstenliebe-in-Berlin/!5292699/
Viel über Christian ist auch in Wikipedia zu erfahren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Herwartz
Vielen Dank an Monika Matthias für die ERinnerung an dieses Interview:
https://www.youtube.com/watch?v=J0OoA_112oE
Beitragsfoto: Wolfgang Borrs